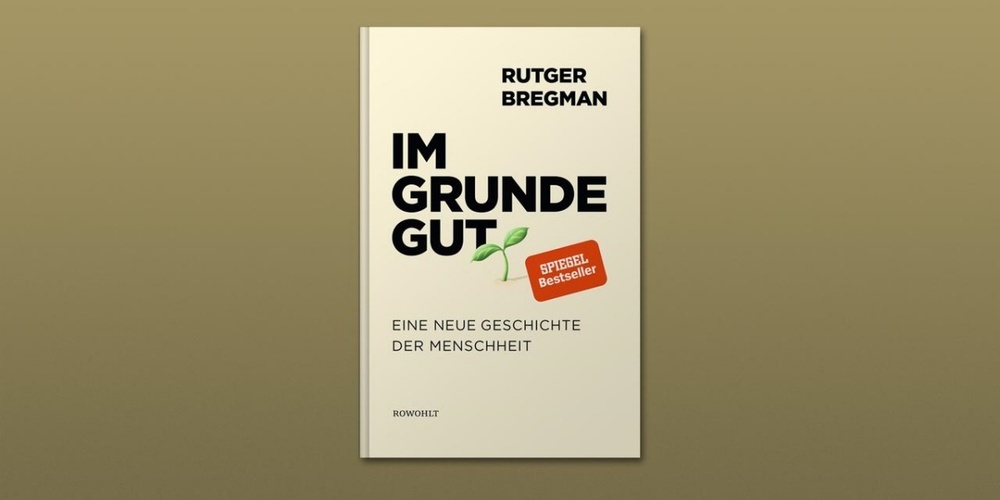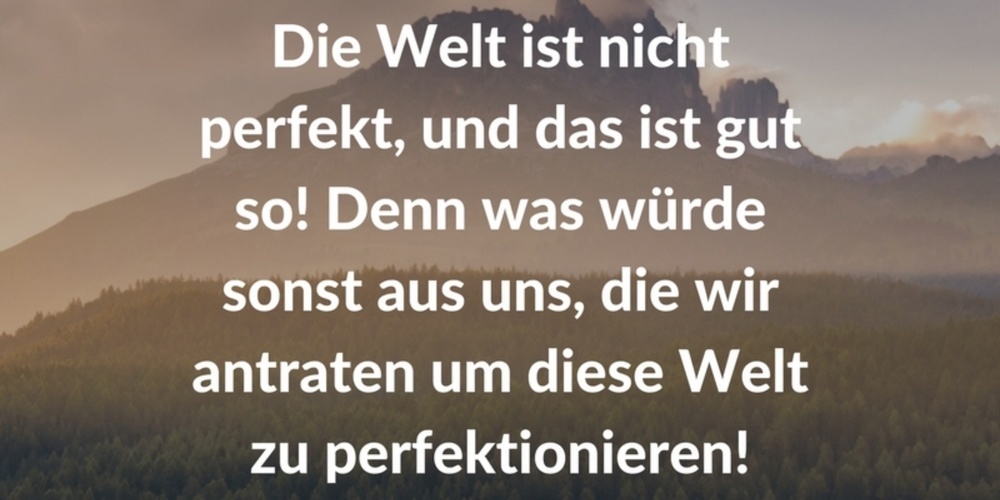Im Grunde ist der Mensch gut: Zu diesem Fazit kommt der Historiker Rutger Bregman. In seinem Buch schreibt er im Untertitel: «Eine neue Geschichte der Menschheit».
Er widerspricht darin den Philosophen wie Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau und nimmt somit den Menschen rein wissenschaftlich unter die Lupe.
Ist der Mensch grundsätzlich schlecht
«Was wäre, wenn in Bewährungssituationen unter dem dünnen Firnis der Zivilisation gar kein bösartiges, barbarisches Wesen zum Vorschein käme, sondern ein grundgutes? Eines, das nicht nur die eigenen Interessen im Blick hat, sondern auch die der Gemeinschaft. Ein Gedanke, der angesichts leer gekaufter Supermarktregale und zu Wucherpreisen gehandelter Atemschutzmasken in Zeiten der Corona Krise durchaus abwegig erscheint».
Der Mensch ist freiheitsliebend
Rutger Bregman meint, dass ein Blick in die Historie sich lohnt. Immerhin verschätzte sich schon Winston Churchill, weil er meinte, dass die deutschen Bombardements während des zweiten Weltkrieges nicht nur die britischen Städte zerstören, sondern auch Angst und Panik auslösen und somit den Verteidigungswillen der Bevölkerung schwächen würden. Doch die psychiatrischen Notaufnahmen blieben leer, und es ging sogar mit der mentalen Gesundheit der Briten bergauf, der Alkoholmissbrauch nahm ab und weniger Menschen begangen Selbstmord als angenommen. Das Fazit mutet etwas seltsam an: «Die britische Gesellschaft wurde durch den Luftkrieg in vielerlei Hinsicht stärker», schrieb ein britischer Historiker später. Jeder half jedem und zuletzt war Hitler enttäuscht?